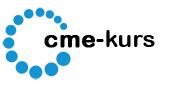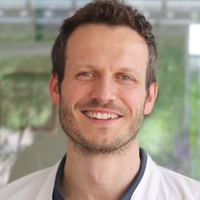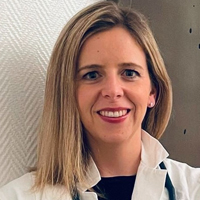(0:15 - 10:30) Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Atemweg, die es in sich hat. Und das meine ich wortwörtlich, denn diese Folge ist zertifiziert. Als Ärztin oder Arzt können Sie im Anschluss CME-Punkte erlangen, indem Sie eine Lernerfolgskontrolle absolvieren.
Der Test liegt auf der Webseite des CME-Verlags. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Aber natürlich hat diese Ausgabe es auch inhaltlich in sich.
Ich habe mich in Köln mit Doktorin Martina Große Sundrup in Strähnen im MVZ K22, niedergelassene Fachärztin für Pneumologie und Schlafmedizin und Professor Christoph Schöbel, Kardiologe, Schlafmediziner, Leiter des Instituts für Digitale Schlafmedizin Essen, hier ist er auch verantwortlich für das Zentrum für Schlaf- und Telemedizin an der Ruhrlandklinik Essen, getroffen. Die beiden, das werden Sie im Verlauf der Aufnahme merken, kennen sich sehr gut, denn sie haben in Essen an der Ruhrlandklinik zusammengearbeitet. Wir haben Fragen rund um schlafmedizinische Aspekte bei Atemwegserkrankungen besprochen und los geht's mit Professor Schöbel, im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Schlafmedizin und der Antwort auf die Frage, wann schlafbezogene Atmungsstörungen überhaupt pathologisch zu nennen sind.
Eine gute Frage, weil die meisten Leute kommen ja, ehrlich gesagt, mit dem Symptom Schnarchen. Da kommen ziemlich viele Männer, werden von ihren genervten Frauen geschickt und dann geht es erst mal los, dass man sich anguckt, Mensch, ist das ein normales Schnarchen oder ein krankhaftes Schnarchen? Schnarchen tun natürlich viele und je älter wir werden, umso eher schnarchen wir auch. Warum? Weil die Atemwege im Halsbereich natürlich nicht durch Knochen oder Knorpel stabilisiert sind, sondern nichts anderes sind als ein Muskelschlauch.
Der Preis der Natur, den wir alle bezahlen müssen, damit wir so quatschen können, wie wir quatschen. Kranker wird es dann, wenn die Atemwege im Schlaf so eng werden, dass einfach zu wenig Luft in die Lunge geht und dann kriegt der Körper mit, es kommt kein frischer Sauerstoff nach, ich drohe zu ersticken. Das wird zum Glück niemals passieren, ansonsten wäre die Menschheit schon längst ausgestorben.
Der Körper macht sich immer rechtzeitig wach, auch wenn dann die entsprechenden Ehepartnerinnen oder Partner daneben sitzen und sagen, ich habe Angst, dass der oder die erstickt. Das wird, wie gesagt, niemals passieren. Deswegen gucken wir uns natürlich auch immer an, Mensch, wie viele dieser Atmungsstörungen, dieser Atemaussetzer sind da wirklich da? Aber natürlich behandeln wir keine Zahlen, sondern wir müssen auch so ein bisschen gucken, Mensch, ist da eine Symptomatik dahinter? Fühlt derjenige, dass er nicht mehr gut schläft oder ist er tagsüber müde oder sogar schläfrig? Und vor allen Dingen, was hat er für Begleiterkrankungen? Weil logischerweise unbehandelte Atmungsstörungen können nicht nur zu Folgeerkrankungen führen, gerade Herz-Kreislauferkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder Demenz, sondern sind natürlich auch in Verbindung zu sehen mit anderen chronischen Erkrankungen und können sich gegenseitig negativ beeinflussen.
Und da sind wir bei dem Thema, darauf werden wir gleich ja noch gehen, auf was muss ich eigentlich achten in der Diagnostik? Ich glaube, das ist gar nicht so unkomplex, wenn wir von Komorbiditäten sprechen. Aber bevor wir da einsteigen, Schnarchen tun viele. Wie präsent ist denn das Thema der pathologischen Erkrankungen überhaupt in der Praxis? Gute Frage ebenfalls.
Schnarchen tun viele, das stimmt. Ich würde sagen, generell ist das Thema Schlaf, Schnarchen, schlafbezogene Atmungsstörungen oder insbesondere Schlafstörungen generell ist ein Riesenthema in der Praxis. Also zum einen sieht man es in jeder zweiten Apothekenrundschau, würde ich sagen, dass es so grob angepriesen wird.
Dann haben eigentlich nahezu alle großen Krankenkassen auch mal Umfragen gemacht bei ihren Mitgliedern, ob Schlafstörungen eine Rolle spielen und dabei ist rausgekommen oder was vermuten sie, was rausgekommen ist? Wie viele Patienten klagen über Schlafstörungen? Das ist jetzt erwischen, ich bereite mich immer sehr gut vor und das habe ich mir nicht angeguckt. Tatsächlich jetzt aus dem Bauch raus, ich würde mal ein Drittel schätzen, haue ich jetzt einfach mal raus. Gar nicht mal so schlecht, aber es sind tatsächlich bis zu 80 Prozent.
Das heißt jetzt nicht, dass jeder behandelt werden muss natürlich, aber 80 Prozent klagen darüber, dass sie eventuell ab und zu mal nicht gut geschlafen haben oder eine Schlafstörung haben und wenn man jetzt auf die schlafbezogenen Atmungsstörungen geht, also vor allem die obstruktive Schlafapnoe, das ist da ja unsere Haupterkrankung, da gibt es gute epidemiologische Daten, die eben weltweit eine Prävalenz von ungefähr einer Milliarde Patienten beziffern, das ist natürlich eine riesige Menge. In Deutschland gibt es auch Daten, je nach Studie und je nach Menge von Atempausen, die man dann ansetzt als Diagnostik, kann man davon ausgehen, dass bei den Frauen um die knapp 30 Prozent und bei den Männern wahrscheinlich sogar 50 Prozent, auch mit einer hohen Dunkelziffer betroffen sind und daher ist das schon ein Riesenthema. Aber wie Christoph gesagt hat, es spielt natürlich eine Rolle, hat man eine Störung, hat man Symptome, welche Vorerkrankungen liegen vor und das müssen wir auseinandersortieren.
Genau, denn diese Zahlen, die du gerade genannt hast, die beziehen sich ja immer nur auf diesen Apnoe-Hypopnoe-Index, also wie viele Atmungsstörungen pro Stunde habe ich und wenn ich da 1000 Leute von der Straße wegnehme und einfach ins Schlaflabor lege, egal ob die Probleme haben oder nicht, kommen wirklich diese Zahlen raus, aber die Frage ist ja wirklich, wen müssen wir behandeln und das ist umso wichtiger, weil ganz ehrlich, die Leute können das mittlerweile ja schon selbst messen. Es gibt Apps, es gibt Smartwatch-Funktionen, die wirklich Atmungsstörungen im Schlaf messen und die machen das vor allen Dingen jede Nacht im Schlaflabor. Wir kommen da dann später nochmal drauf, messen mal vielleicht ein oder zwei Nächte in einer fremden Umgebung, da schläfst du definitiv nicht so wie zu Hause und genau deswegen ist es glaube ich wirklich wichtig zu gucken, nicht nur auf so einen blöden Wert.
Ja klar, Werte helfen uns, aber im Endeffekt müssen wir uns wirklich angucken, wen müssen wir denn da auch weiter diagnostizieren und vielleicht sogar auf eine Therapie einstellen, denn wenn wir jeden, der irgendwie einen erhöhten Wert haben, auf die Standardtherapie, die Überdrucktherapie, so eine Maske einstellen würden, sorry, das würden die Leute gar nicht mitmachen, wir können es uns gar nicht leisten und dann hätten wir ehrlich gesagt noch längere Wartezeiten vor den ganzen Schlaflaboren. Das ist aber ein guter Punkt, Smartwatches, digitale Devices, das ist auch bezüglich Präsenz in der Praxis ein Riesenthema, also die Leute kommen an, bringen ihre Auswertung mit von der Apple Watch, von was auch immer und sagen, gucken Sie mal, ich hatte überhaupt keinen Tiefschlaf, ich habe seit Wochen zu wenig geschlafen, mein Sauerstoffgehalt ist schlecht, da müssen wir darauf reagieren, also das ist auch zum Thema Präsenz in der Praxis, die Patienten kommen auch mit solchen Daten. Genau.
Und da werden wir dann zunehmend zum Berater der Patienten, weil eben nicht alle Devices wirklich unbedingt das messen, was sie vorgeben zu messen, wir wissen es zum Teil gar nicht. Ich finde das super wichtig, was gerade gesagt ist, wir müssen zum Berater werden, weil wenn so ein Automatismus einsetzt, einfach nur oh, das ist ein Medizinprodukt, oh, da kommt ja was Krankhaftes raus, oh, jetzt geht es aber hier weiter mit der Diagnostik, dann schleusen wir Patienten in so einen Diagnostikpfad, der aktuell schon überlastet ist und dann erreicht man ehrlich gesagt genau das Gegenteil. Dann haben wir vielleicht die falschen Leute oder nutzen unsere Ressourcen für die falschen Leute und die richtigen müssen Ewigkeiten warten.
Das heißt, hier müssen wir wirklich ins Gespräch kommen, denn aktuell ist es sehr starr, auch der Diagnostikpfad, den werden wir gleich nochmal ansprechen, weil wir eine Richtlinie haben von der Politik, die müssen wir sozusagen einhalten und einmal in dieses System reingeschleust, zack, läuft der Patient diese ganzen Stufen da ab. Ob das was bringt, werden wir dann häufig erst im Nachgang wissen, allerdings kann man im Vorfeld schon ganz gut selektieren. Bleiben wir mal bei dem Vorfeld und gleich werde ich auf die Smartwatches, die ganzen Möglichkeiten zurückkommen wollen.
Ich selber trage auch eine und habe irgendwann beschlossen, sie nachts einfach auszuschalten, aber dazu gleich mehr. Warum? Starten wir nochmal vorne bei der Diagnostik. Christoph Schöbel, Sie haben es gerade skizziert, wir haben endliche Ressourcen und Medizin ist mehr als nur die Ansammlung von Werten, weil sonst könnte es dann am Ende doch auch eine Maschine machen und sagen, du hast das, du machst dies, du machst jenes.
Es geht um die Interpretation, es geht um die Begleitung, engmaschig, beratend. Muss ich denn jetzt, wenn ich jetzt feststelle, ich habe Schlafaussetzer, das habe ich gerade gelernt, daran ersticken werde ich nicht, und so schlau ist unser Körper, das zu verhindern, soll ich sofort einen Termin im Schlaflabor machen, am besten Uniklinik Essen und melde mich schon mal an? Oder wie gehe ich denn vor? Wer ist für was verantwortlich? Also generell ist es genau so, wir müssen das Risiko ein bisschen besser abschätzen, also es reicht nicht nur aus, dass jemand schnarcht und zack, dann geht es los mit der ganzen Diagnostik, man muss ein bisschen drum herum gucken, wer ist denn das eigentlich? Ganz, ganz wichtig ist eine Fremdanamnese, häufig von der Bettpartnerin oder dem Bettpartner, heißt also, ist das Schnarchen zum Beispiel wirklich mit Atemaussetzern verbunden? Ist das schon mal festgestellt worden? Weil derjenige, der es hat, der weiß davon in der Regel nichts. Wie geht es demjenigen? Hat er noch andere Risikofaktoren? Hat er vielleicht sogar schon einen Bluthochdruck? Ist er übergewichtig? Das Alter spielt eine große Rolle, das Geschlecht spielt eine Rolle, das heißt, das muss alles mit beachtet werden.
Mittlerweile gibt es super standardisierte Fragebögen, die sind ziemlich schnell gemacht und die können das Risiko schon gar nicht so schlecht abschätzen. Die Tools gibt es mittlerweile auch digital, heißt also, da kann man schon mal gucken, Mensch, wie hoch ist das Risiko, dass ich wirklich ein krankhaftes Schnarchen habe, nicht nur ein einfaches Schnarchen. Und deswegen ist das ganz, ganz wichtig, von Anfang an wirklich zu gucken, wie hoch ist denn das Risiko? Und dann kann man auch die richtigen Leute in den weiteren Prozess mit reinnehmen.
Klar ist auch die ganzen Smartwatch-Funktionen, wenn das ein Medizinprodukt ist. Ich muss natürlich immer erstmal gucken, was zeigt denn der oder diejenige mir? Solange das alles Lifestyle ist, ist das überhaupt nicht bewiesen, was diese App da überhaupt aufzeichnet. Das kann man, ehrlich gesagt, lockerflockig vom Tisch wegwischen, weil das kann ich nicht für eine Diagnostik verwenden.
Allerdings gibt es mittlerweile die ersten Medizinprodukte. Es gibt zwei große Smartwatch-Hersteller, die sind in den Staaten bereits zugelassen als Medizinprodukt zur Erkennung von Schlafapnoe. Das heißt, so was muss ich dann schon ein bisschen anders bewerten als irgendeine App, die ich mir kostenlos runtergeladen habe.
Aber natürlich trotzdem immer im Zusammenhang auch mit den anderen Risikofaktoren, Symptomen, Komorbiditäten. Und die Interpretation oder mein erster Berührungspunkt als Betroffener wäre dann aber bei Ihnen in der Niederlassung, Dr. Grosse-Sundrup, oder erstmal in der hausärztlichen Praxis. Also auch wenn wir die Bögen haben, wer macht denn dieses erste Screening, wer soll denn hinschauen? Also das erste Screening ist sicherlich beim Allgemeinmediziner, würde ich sagen, weil die sehen die Patienten in erster Linie und das ist auch mit eines der häufigsten Symptome.
(10:31 - 11:25)
Schlafstörungen werden häufig beklagt und da ist es wie so häufig in der Medizin wichtig, einfach dran zu denken. Mensch hat eine Schlafstörung, weil gerade der Opa gestorben ist, weil irgendwelche Probleme in der Beziehung bestehen, im Beruf, im Privaten. Der Schlaf spiegelt das ja alles wieder und ist so ein bisschen der Seismograph aller körperlichen Befindlichkeiten, sage ich mal.
Und da hat man die ersten Berührungspunkte und da kann dann schon abgeschätzt werden, genau wie Christoph das gesagt hat, sind die Symptome jetzt eher vorübergehend? Hat der Patient überhaupt Symptome, die ihn über Tag beeinträchtigen? Was für Vorerkrankungen hat der Patient? Ist er ein Hochrisikopatient für eine Schlafapnoe? Und anhand dieser ganzen Geschichten würde man dann abschätzen, liegt da vermutlich eine Atemstörung vor oder nicht? Und wenn ja, dann würde man den Patienten weiter überweisen zu einem Facharzt. Der Facharzt würde dann eine sogenannte Polygrafie machen. Das ist eben so ein Screening, sage ich mal, wo die Atmung im Schlaf an der Nase gemessen wird.
(11:26 - 12:47)
Zudem gibt es dann zwei Gurte, einmal am Brustkorb, einmal am Bauch, die die Atembewegung messen. Am Finger wird der Sauerstoffgehalt im Blut gemessen und auch der Puls sowie auch die Lage. Und anhand dieser ganzen Parameter kann man dann schon einen Hinweis bekommen, ob die Atmung im Schlaf stabil ist oder eben nicht.
Der Vorteil ist inzwischen aber, dass viele Ärzte diese Untersuchung durchführen können. Man muss da einen speziellen Kurs für machen und das kann vom Allgemeinmediziner über den HNO-Arzt, über den Kardiologen, den Pneumologen, den Pädiater, den Neurologen, also viele Fachärzte können diese Untersuchung durchführen. Und daher würde ich sagen, es ist einfach wichtig daran zu denken, dass man auch die schlafbezogenen Atmungsstörungen auf dem Schirm hat, sage ich mal, und dass man nicht sagt, Mensch, der Patient hat einfach eine Schlafstörung, die keine körperliche Ursache hat.
Und wenn man das Gefühl hat, da könnte was Körperliches hinterstecken oder er hat ein hohes Risiko, dann, wenn man es nicht selbst durchführen kann, mit der Polygrafie gerne weiterschicken. Und du hast einen wichtigen Punkt. Ich glaube, die Allgemeinmedizinischen Kolleginnen und Kollegen sind wirklich die Ersten, die diese Patienten sehen.
Das Riesenproblem ist, Schlafmedizin wird im Studium kaum gelehrt. Ich vertrete den Lehrplan bei uns an der Uniklinik in Essen. Das sind 45 Minuten Vorlesung in zwölf Semester Medizinstudium.
Wenn ich mir überlege, Schlafstörungen, du hast vorhin gesagt, in den großen Krankenkassenschulen 80 Prozent der Leute erzählen, dass sie schlecht schlafen. Ja klar, schlecht schlafen tut mal jeder. Klar, wenn ich Probleme habe, klar schlafe ich schlecht.
(12:48 - 17:41)
Ja, das wissen wir seit Kindheit. Dass das, was tagsüber uns belastet, wir auch in den Schlaf mitnehmen, heißt ja nicht, dass 80 Prozent gleich zum Schlafmediziner müssen. Und das Riesenproblem ist, es gibt so viele verschiedene Schlafstörungen und häufig wird immer das Ganze nur auf irgendwelche Atmungsstörungen runtergebrochen.
Das heißt, wir sehen auch häufig, dass Patienten, die ein ganz anderes Problem haben, dann aber in die Schiene schlafbezogene Atmungsstörungen reinkommen, weil sie halt gesagt haben, ja, schnarch mal. Heißt aber noch längst nicht, dass das eigentlich das Problem ist. Manchmal sind es auch Läuse und Flöhe, die man haben kann.
Das heißt, diese Initiale auf die Schiene setzen, auf die Schiene bringen, das ist super wichtig. Und du hast es gesagt, es sind natürlich viele Sachen, an die man denken muss und das hat man vielleicht auch nicht immer auf dem Schirm. Gerade als Allgemeinmedizinerin und Mediziner muss man irgendwie die ganze Bandbreite auf dem Schirm haben.
Und das funktioniert ja nicht. Deswegen gibt es auch wirklich gute Fragebögen, strukturierte Fragebögen, die ich dann einsetzen kann, ohne dass ich das immer gleich alles im Kopf parat haben muss. Die ich aber auch einsetzen sollte.
Also bei mir hat das gerade, wenn ich jetzt an kardiovaskuläre RisikopatientInnen denke, ein Hochdruck. Da ist dann irgendwann die Niere auch nochmal mehr in den Fokus gekommen, was sich jetzt organisch-physiologisch eigentlich, wo man denkt, ja klar, aber natürlich aufgrund der vielen Dinge, die man im Auge haben muss und war so ein Fokus vielleicht auf der Kardiologie. Jetzt rutschen die Nephrologen, es gibt dann vielleicht irgendwann die Kardionephrologie oder Nephro-Kardiologie, das dürfen die Fachgesellschaften unter sich ausmachen.
Müsste das dann auch so was sein, dass ich beispielsweise beim Check-Up 35 in der Praxis auch eben die Schlafmedizin mit in so eine Anamnese mit reingehe? Super Idee, denn Schlaf ist Prävention, Schlaf ist Kopfgesundheit, Schlaf ist Herzgesundheit und man muss ganz klar sagen, gesunder Schlaf ist seit letztem Jahr durch die amerikanische Kardiologische Gesellschaft wirklich als achter kardiovaskulärer Risikofaktor mit aufgenommen worden. Wir haben im Studium immer gelernt, nicht rauchen, richtig sich ernähren, sich bewegen, kein Übergewicht, Blutdruck muss eingestellt werden, Blutfette müssen eingestellt werden. Gesunder Schlaf gehört jetzt mit dazu, weil Prävention, du kannst dich ernähren, wie du willst, wenn du nicht ausreichend schläfst, bringt das alles nichts.
Und das sind sozusagen auch wirklich neue Erkenntnisse aus großen epidemiologischen Studien, wer nicht ausreichend schläft, stirbt wirklich zeitiger an einer kardiovaskulären Erkrankung wie Herzinfarkt und Schlaganfall. Das ist wirklich wichtig, dass man das sozusagen auch ein bisschen in die Köpfe mit reinkriegt, denn früher war Schlaf ehrlich gesagt ziemlich uncool, da waren diejenigen, die wenig schlafen, das waren die Leistungsträger, die nur vier Stunden gepennt haben. Mittlerweile hat sich das ein bisschen gewandelt, finde ich gut.
Ich glaube, da haben die Smartwatches auch so ein bisschen mit dem Buß gegeben, weil plötzlich kann man zumindest Schlaf abschätzen, auch wenn ich das bei Schlafgestörten, wie du schon vorhin gesagt hast, ehrlich gesagt häufig nicht empfehle, Schlaf zu messen, ansonsten werden die noch fixierter. Darüber müssen wir gleich reden, Chancen und aber auch die Risiken, die Herausforderungen. Aber ein Check-Up, die Idee, die finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil häufig merkt man ja auch in der Praxis, dass die Patienten wirklich sehr spät kommen.
Die kommen mit, ich weiß nicht, teilweise auch 75 und hatten schon drei Herzinfarkte und zwei Schlaganfälle, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sind halt schwer vorerkrankt und sagen dann, die Beschwerden hatte ich eigentlich schon, seitdem ich 40 bin oder 35, was auch immer. Von daher einen Check-Up zu machen, um auch rechtzeitig eine mögliche Therapie einleiten zu können, das finde ich schon sehr sinnvoll, um eben die Sachen, die Christoph erwähnt hat, um denen vorzubeugen. Daran denken, das ist ein Stichwort, was wir ganz häufig hier bei Atemweg haben und das zeigt einfach, ich meine klar, wenn man im Studium 45 Minuten darüber redet, dann kann man sich natürlich vorstellen, dass das auch schwierig ist, das alles präsent zu haben.
Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass ich heute Morgen mich noch mal hingelegt habe. Ich war sehr früh wach und jetzt habe ich gerade gehört, ich habe fast für meine kardiovaskuläre Gesundheit gedacht. Bleiben wir mal noch bei der Diagnostik.
Dieses Schlaflabor, diese Vorstellung, Christoph Schöbel hat es ja eben auch schon gesagt, da in so ein Ding zu gehen, überall Kabel zu haben, eine Maske eventuell auf der Nase zu haben und dann jetzt schlaf mal schön. Aber wenn ich diesen Schritt gegangen bin, was kann ein Schlaflabor leisten, was kriege ich mit, weil wir haben ja eben schon über die Erstdiagnostik sozusagen gesprochen, jetzt soll ich ins Schlaflabor, wo liegen aber auch die Grenzen der Möglichkeiten? Ehrlich gesagt, zur Diagnosesicherung müssten gar nicht alle in ein Schlaflabor. Wenn ich nämlich einen Patienten habe, der die typischen Symptome hat und ich habe wirklich einen zweifelsfreien Polygrafiebefund, dann kann ich auf dieser Basis wirklich schon die Diagnose stellen, dass die Therapiebedürftige Schlafapnoe da ist.
Häufig ist es aber leider so, dass entweder die Polygrafie nicht zum Symptom passt oder andersrum, dass ich nicht so richtig weiß, ist das nicht richtig Fisch, ist das nicht richtig Fleisch. Dann geht es auch ins Schlaflabor, um die Diagnose noch mal zu bestätigen. Aber das große Problem ist natürlich, es ist nicht die gewohnte Umgebung.
Die Leute liegen dann häufig auf dem Rücken. Gerade auf dem Rücken sind viele Atemaussetzer da, weil sie sich nichts runterreißen wollen. Dann ist die ganze Atmosphäre nicht so wie zu Hause.
(17:41 - 18:15)
Wir wissen ja auch, abendlicher Alkoholkonsum spielt da auch mit rein. Ich weiß gar nicht, warum Sie mich jetzt so angucken. Deswegen sagen wir unseren Leuten immer, unseren Patienten, bringen Sie sich bitte das an den alkoholischen Getränken mit, was Sie regelmäßig abends zu sich nehmen, wenn Sie zumindest mal ein realistisches Abbild haben wollen.
Aber das große Problem ist schon, dass diese Schlaflaboruntersuchung schon sehr ressourcenintensiv ist. Nicht nur Zeit, Personal, Kosten. Wir haben längste Wartezeiten in einem deutschen Schlaflabor, das sind 24 Monate.
(18:16 - 18:29)
Durch Corona haben ganz viele stationäre Schlaflabore auch zugemacht. Auch die Vergütung eines stationären Schlaflabors ist immer wackeliger, weil die Krankenkassen das gerne in den ambulanten Bereich haben wollen. Ambulant heißt nicht, dass man es zu Hause machen kann.
(18:29 - 18:53)
Nein, man geht da auch ins Schlaflabor, aber geht da halt nur zum Schlafen hin. Das wird dann häufig von niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen angeboten. Das ist ja was, was im Gesundheitssystem auch gewollt ist, dass wir die Sektoren aufbrechen, dass mehr ambulante Versorgung ist.
(18:53 - 19:10)
Sind denn die Möglichkeiten genauso gut in der ambulanten Versorgung oder gibt es vielleicht sogar Vorteile für die Betroffenen, weil schnellere Umsetzung? Wie ist das? Die Untersuchung ist letzten Endes die gleiche, muss man sagen. Es werden die gleichen Geräte verwendet. Die Polysomnographie ist ja nach wie vor unser Goldstandard.
(19:10 - 19:50)
Noch gibt es keine zertifizierte Alternative, auch wenn sich das viele Leute wünschen würden. Denn genau wie Christoph gesagt hat, diese Polysomnographie bildet natürlich nicht eins zu eins den Schlaf ab, den man auch zu Hause hat. Wir sind an 50 Strippen angekabelt und sollen dann ganz entspannt schlafen.
Das funktioniert nicht so wahnsinnig gut. Nichtsdestotrotz ist es die erste Wahl, um körperliche Ursachen für eine Schlafstörung auszuschließen. Im ambulanten Bereich ist es so, dass die Patienten abends kommen, morgens ziemlich früh wieder gehen.
Die Verkabelung ist dieselbe. Und letzten Endes messen wir auch dieselben Sachen. Es ist natürlich von Vorteil, weil manche Patienten nicht unbedingt zwei oder drei Tage im Krankenhaus bleiben möchten.
(19:50 - 19:59)
Die müssen über den Tag zur Arbeit, die müssen ihre Kinder versorgen. Von daher ist so eine ambulante Geschichte von Vorteil. Und wie Christoph gesagt hat, es haben eben auch viele stationäre Schlaflabor zugemacht.
Und dann haben mehr ambulante Plätze eröffnet. Aber auch da sind die Wartezeiten ähnlich lang. Von daher ist es nach wie vor problematisch.
Und das hat natürlich auch die Industrie erkannt. Es gibt zunehmend Lösungen, die man mit nach Hause nehmen kann, um zu Hause den Schlaf abzubilden, auch kontaktlos zum Teil. Da wird Christoph sicherlich gleich noch was zu erzählen.
Aber ansonsten ist die ambulante Versorgung genau wie stationär. Es gibt natürlich bestimmte Schlafstörungen, wo man auch über Tagmessungen machen muss, wo man Einschlaflatenzen gut beurteilen muss. Und dafür ist sicherlich die Domäne die stationäre Diagnostik.
(20:31 - 21:20)
Im Endeffekt müssen wir halt gucken, dass wir die richtigen Patienten an den richtigen Standorten anbinden. Heißt also, wenn ich Patienten habe, die jetzt wirklich pflegebedürftig sind oder schwere Komorbiditäten haben, die gehören eigentlich in ein stationäres Schlaflabor, weil stationär kann ich zum Beispiel Zusatzuntersuchungen machen. Du hast gerade die Tagesuntersuchungen genannt, aber auch Blutgasanalysen, Kapnographien, also die transkutane Kapnographie zum Beispiel, um kontinuierlich CO2 zu messen.
Das sind alles so Sachen, die ich im stationären Schlaflabor anbieten kann. Aber es müssen halt die richtigen Patienten dahin kommen. Das heißt nicht, dass gleich jeder in ein stationäres Schlaflabor muss, aber im Endeffekt müssten wir eigentlich viel, viel besser sein, die richtigen Patienten richtig hinzusteuern.
Aktuell ist es leider so, die Patienten gehen dahin, was halt am nächsten ist. Also wenn das nächste Schlaflabor um die Ecke ein ambulantes ist, gehe ich dahin. Wenn es das stationäre ist, gehe ich dann dahin.
(21:21 - 21:45)
Das haben die bayerischen Kollegen gut hinbekommen. Die haben nämlich in der Tat Kriterien definiert, wo sie gesagt haben, okay, da haben sich alle einmal zusammen hingesetzt, Krankenhausgesellschaft, Krankenkassen und die Ärzte, und haben wirklich mal gesagt, okay, wer muss in ein ambulantes Schlaflabor, wer muss in ein stationäres Schlaflabor. Heißt also, da gibt es dann nicht diesen Konkurrenzkampf zwischen den Schlaflaboren, sondern es ist ganz klar, okay, das sind Kriterien, wo ein stationäres Schlaflabor bezahlt wird, das sind Kriterien für ein ambulantes Schlaflabor.
(21:45 - 22:11)
Das haben wir von der Fachgesellschaft auch mit aufgenommen, diese Kriterien. Aber es ist natürlich wahnsinnig schwierig, wenn du dann in Bundesländern bist, wo sich eben die Player nicht zusammengesetzt haben, sondern dann jeder vor sich hin werkelt und dann zum Beispiel Krankenkassen stationäre Schlaflaboraufenthalte wegstreichen, weil der medizinische Dienst sagt, nee, gab es gar keine Indikation für. Und dass du dann nach Krankenkassen guckst, ob du Patienten überhaupt versorgen kannst, weil vielleicht Krankenkasse XY kein stationäres Schlaflabor mehr bezahlt.
(22:11 - 23:21)
Als nächste Frage steht hier auf meinem Spickzettel die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Das nehme ich ja jetzt schon mal auf, wie wichtig es wäre, um auch einen Patientenstrom sinnhaft zu steuern und gestalten zu können. Vielleicht ganz kurz nochmal nachgefragt, ich habe aber eben auch rausgehört, eigentlich sind es ja dann nur, und das gehört ja zur Steuerung dazu, Betroffene, wo ich differenzialdiagnostisch unsicher bin und nochmal genau hinschauen müsste, möchte, gleichzeitig könnte ich aber viele auch schon diagnostizieren mit einer Schlafapnoe, mit der einfacheren Methode in Anführungsstrichen.
Trauen wir uns das nicht? Also gibt es da eine Erklärung für? Ist eine komische Frage, weil so ein bisschen subjektiv im Erleben. Aber woran liegt das denn, dass wir da so ein Bias haben und vielleicht den ein oder anderen ins Schlaflabor schicken? So ein bisschen so was wie, ja, guck lieber doch nochmal nach? Genau, einmal ist es halt so, diejenigen, die diese häusliche Messung machen, sind nicht immer unbedingt diejenigen, die das Schlaflabor auch betreiben. In Tinas Fall ist es so, sie macht die Polygrafie, sie kann auf die Rohdaten zugreifen, sie kann sich das nochmal angucken und hat nicht nur einen Befundausdruck, wo eine Zahl draufsteht.
(23:22 - 23:51)
Sie kennt den Patienten, sie weiß, was derjenige hat und kann dann selbst entscheiden, reicht mir das, um die Diagnose zu stellen, kann ich den gleich einleiten auf eine Therapie? Häufig sind es aber leider nicht dieselben Personen. Heißt also, ich kriege einen Patienten zugewiesen von einem niedergelassenen Kollegen, ich sehe bloß den Ausdruck, der Patient sagt mir, ach naja, eigentlich so richtig repräsentativ war die Nacht nicht. Ja, was machst du denn dann? Da sagst du dir, okay, komm, ich dir jetzt so eine Maske aufsetze, die du dann bis zum Rest deines Lebens tragen musst, gucke ich es mir lieber nochmal an.
Nächstes Ding ist, du musst deine Ressourcen ja auch irgendwie planen. Wir haben ewig, wir haben wirklich Monate Wartezeit und natürlich planen wir dann zwei Nächte pro Patient ein. Und wenn der Patient dann vor der Tür steht, sagst du nicht, okay, komm, eine Nacht reicht, dann steht das Bett leer.
Und selbst, wenn du das so machst und ich habe einen Kollegen gesprochen, der hat das wirklich versucht, ganz konsequent umzusetzen. Der hat auch die Möglichkeit einer Polygraphie, hat ein ambulantes Schlaflabor und hat dann wirklich die Leute, einfach um seine Ressourcen besser auszunutzen, über die Polygraphie, wenn er gesagt hat, Mensch, das reicht mir für die Diagnose, wirklich die Diagnose gestellt und hat den wirklich nur zur Einleitung der Therapie ein Schlaflabor geholt. So hat er natürlich deutlich mehr Patienten in einer Zeit im Schlaflabor gehabt, aber dafür musste nach jeder Nacht das Zimmer säubern.
(24:36 - 24:49)
Du musst die Betten neu beziehen, da steckt alles in der Vergütung mit drin. Das muss man sich sozusagen auch immer mit überlegen. Heißt also, du machst es leidlich und gerecht und hast aber sozusagen hinten raus zum Teil noch mehr Arbeit.
Und es ist halt wirklich schwierig, das auch einzuplanen, weil du musst diese Betten, diese Ressourcen musst du verplanen. Und wenn du da bloß eine Nacht für einen Patienten planst und da sagst du, scheiße, hättest du eine zweite Nacht für gebraucht. Ja, wann ist die zweite Nacht wieder frei? Sechs Monate später.
Also, das ist ein Riesenproblem und ich glaube, da müssen wir uns wirklich auch zusammensetzen. Und ich glaube, da ist es auch ganz, ganz wichtig, die Karten offen zu legen, weil aktuell sehe ich zum Beispiel diese Aufzeichnung gar nicht, die du auf dem Computer hast, weil es keine Möglichkeit gibt, die Daten auszutauschen. Die Daten sind nicht standardisiert.
(25:22 - 25:32)
Aktuell schickt man Patienten mit irgendwelchen Befundberichten durch die Gegend, wo irgendwelche Zahlen draufstehen. Und das finde ich immer schwierig. Da sind wir ja schon wieder auch im Thema Digitalisierung.
Vielleicht wird das ja irgendwann mal besser. Ja, Digitalisierung bedeutet ja nicht nur EBA, sondern bedeutet ja auch das Lesbarmachen von Daten. Interoperabilität ist, glaube ich, das Stichwort da.
Also, was ich schon mal mitgenommen habe, und das ist ein Appell, ich nenne das jetzt mal das bayerische Modell, könnte so eine Idee sein, wie man sowas macht. Leute setzen sich gemeinsam an den Tisch, überlegen, wie das geht und setzen einen klaren Prozess auf. Und der ist gut für die PatientInnen, der ist aber gut auch für die Versorgungslandschaft, weil er eine Effizienz möglich macht.
(26:07 - 26:32)
Wer muss denn, jetzt lassen wir mal Krankenkassen und Krankenhausgesellschaften mal außen vor, aber von den Fachrichtungen, wer gehört denn eigentlich dazu? Also, dass jetzt eine niedergelassene Pneumologin mit einem Pneumologen in der Klinik zusammenarbeitet, ist jetzt nicht so richtig überraschend. Dass jetzt die Hausarztpraxis noch mit reinkommt, ist auch nicht so wirklich überraschend. Wem brauchen wir denn noch am Tisch? Schlafmedizin ist super interdisziplinär, würde ich sagen.
Das ist mit die interdisziplinärste Fachrichtung, die wir haben, da der Schlaf eben alle Patienten eigentlich betreffen kann. Neben denen, die Sie jetzt genannt haben, sind die HNOler auch eine sehr große Gruppe, die sich mit den Patienten beschäftigen. Da wird auch das Schnarchen oft erwähnt, damit geht's los.
Die Interdisziplinarität ist aber auch wichtig für die Therapie hinterher, letzten Endes. Also, wir haben über die berühmt-berüchtigte Schlafmaske schon mal kurz gesprochen. Es gibt inzwischen aber auch viele Alternativtherapien, und auch gerade da kommt die Interdisziplinarität zum Tragen.
Wieder die HNOler, die können heute sogenannte Zungenschrittmacher oder Hypoglossostimulatoren den Patienten implantieren. Das sind letzten Endes Therapien, die nachts durch einen Sensor die Zunge nach vorne schieben. Wenn die eben nach hinten fällt, ist sicherlich für einige eine gute Alternative.
(27:19 - 27:44)
Da muss natürlich vorher geklärt werden, kommt der Patient dafür überhaupt in Frage? Fällt der Hals an der richtigen Stelle in dem Fall zusammen? Ist es damit getan, dass die Zunge nach vorne geschoben wird? Oder gibt's vielleicht noch andere Ecken im Hals rundherum, die ebenfalls zusammenfallen? Dann bringt der in dem Fall nichts. Dann gibt's die Unterkieferprotrusionsschiene. Das ist eine weitere Alternativtherapie, eine Zahnschiene, die den Unterkiefer nach vorne schiebt, sodass im Rachen eben auch ein bisschen mehr Platz entsteht.
Da sind zum einen die Zahnmediziner oder auch die Kieferorthopäden gefragt, die sich das Ganze anschauen. Sind die Zähne überhaupt in Ordnung? Ist der Zahnstatus okay? Kann man das beim Patienten machen oder nicht? Und da überweisen wir eben gerne zu Kollegen, um das einfach alles mal abzuklären, zu prüfen, ob das funktionieren würde oder nicht. Sicherlich sind die Psychiater und die Neurologen auch eine wichtige Gruppe, weil eine große Anzahl der Patienten hat unter Umständen durch die lange Zeit, wo sie schon Probleme haben, auch eine sogenannte Insomnie entwickelt, also eine Durchschlafstörung.
Teilweise ist es nicht damit getan, dass die schlafbezogene Atmungsstörung behoben ist, sondern man muss eben die Komorbiditäten auch behandeln. Letzten Endes haben auch alle Arztgruppen wiederum unterschiedliche Patienten mit unterschiedlichen Risikoprofilen. Und ich finde, dass gerade daher der Schlaf eigentlich super ist, um alle näher miteinander zu vernetzen.
(28:35 - 28:46)
Und vielleicht sollten wir es einfach gemeinsam mal angehen, die Schlafmedizin etwas zu revolutionieren und nicht auf die Politik warten. Genau, aber dazu gehört der Austausch. Das Riesenproblem ist, die Patienten werden dann häufig weitergeschickt.
...